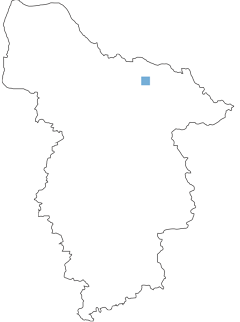Kirchenzentrum St. Stephanus Lüneburg
Als im September 1974 das erste ökumenische Kirchenzentrum Deutschlands im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor eröffnet wurde, war die Euphorie groß. 40 Jahre später hat sich daraus eine eher pragmatische Nüchternheit entwickelt.
Auf dem Platz vor St. Stephanus ist reger Betrieb – und das nicht nur, weil Markttag ist. „Hier herrscht immer ein Kommen und Gehen. Unsere Türen sind weit geöffnet“, sagt Jutta Segger. Die Gemeindereferentin, seit mehr als 25 Jahren vor Ort im ökumenischen Zentrum, kann kaum einmal durchs Foyer gehen, ohne angesprochen zu werden. Die Menschen kennen sie. Und sie kennt die Menschen.
Wie viel Ökumene darf es sein?
Keine Frage, St. Stephanus ist ein Ort der Begegnung, wie ihn sich manche Gemeinde heute wünscht. Mehrmals in der Woche öffnet das Café Contact, die Kleiderkammer ist gut gefüllt und noch besser besucht, die SOS-Sprechstunde steht Hilfesuchenden mit Rat und Tat zur Seite, der Besuchsdienst hat Alte und Kranke im Blick.
Und natürlich wird hier sonntags Gottesdienst gefeiert. Dann gehen die Katholiken in die eine Hälfte der Kirche und die Protestanten in die andere, abgetrennte Hälfte.
Genau dieser Punkt ist es, der bei denen, die vor 40 Jahren das ökumenische Zentrum mit großen Hoffnungen bezogen haben, Resignation und manchmal auch Enttäuschung verursacht. „Der Aufbruchstimmung von damals ist Ernüchterung gefolgt“, räumt Dechant Carsten Menges ein.
Denn ungeklärt bis heute ist die Frage: Was soll ein ökumenisches Zentrum eigentlich bewirken? Soll es lediglich umsetzen, was zwischen den Konfessionen ohnehin abgesegnet ist? Oder ist auch Raum für Experimente? So ein Experiment war in Lüneburg über Jahre die gemeinsame Feier der Osternacht, die in einem entscheidenden Punkt allerdings getrennt gestaltet wurde: hier die katholische Eucharistie, dort das evangelische Abendmahl. „Das, was uns nach wie vor trennt, wollte ja keiner ignorieren“, erinnert sich Dechant Menges. Als auf Bitte von Bischof em. Norbert Trelle eine andere Lösung gesucht werden musste, kam das bei vielen als Verbot an. „Das hängt bis heute nach“, bedauert Menges.
Nach St. Stephanus entstanden im Bistum Hildesheim zwei weitere ökumenische Zentren: in Hannover-Mühlenberg und in Klein Berkel bei Hameln. Würde heute so ein Projekt noch einmal realisiert? Der Dechant gibt sich da eher skeptisch: „Um in konfessioneller Zusammenarbeit Kosten zu sparen, wäre es durchaus sinnvoll. Aber aus theologischen Gründen könnte ich mir das nur schlecht vorstellen.“
Theologisches Abwägen ist den Menschen in Kaltenmoor allerdings eher nebensächlich: Aus dem ursprünglich für junge Familien geplanten Stadtteil ist im Laufe der Jahre ein sozialer Brennpunkt geworden, der von Migranten geprägt ist. Die wenigsten zerbrechen sich hier über ökumenische Befindlichkeiten den Kopf oder fragen nach Konfessionen.
„Hier fühlen sich die Menschen angenommen“
„Gerade deshalb ist es aber wichtig, dass wir als Christen im Stadtteil wahrgenommen werden“, stimmen Carsten Menges und Gemeindereferentin Jutta Segger überein. „Wir bieten als Kirchen gemeinsam einen Platz an, wo die Menschen sich angenommen fühlen. Ob sie allein, arbeitslos oder deprimiert sind – hier ist immer jemand, der für sie da ist und ihnen zuhört. Und das ist schließlich eine wichtige Aufgabe für uns Christen.“
„Das ökumenische Zentrum St. Stephanus hat in 40 Jahren eine andere Funktion bekommen“, sagt Dechant Menges. „Es ist ein Ort der ökumenischen Sozialarbeit. Als evangelische und katholische Kirche übernehmen wir zusammen Verantwortung für unseren Lüneburger Stadtteil.“