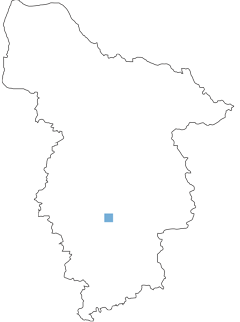Flucht und Vertreibung - Erinnern
70 Jahre Vertreibung und Flucht – ein Datum des Erinnerns. Aber ein besonderes Datum; denn es ist wohl die unwiederbringlich letzte Möglichkeit, dass Menschen zu Wort kommen, die diese Jahre am eigenen Leib erfahren haben. Wer heute Auskunft geben kann, war damals ein Kind, ein Jugendlicher. Diese Generation der Flüchtlinge wird es bald nicht mehr geben.
Was viele der Älteren schmerzlich bis auf das Sterbebett begleitet hat, war das überwiegende Desinteresse an ihrer Geschichte: Im aufstrebenden Nachkriegsdeutschland waren die Menschen mit anderen Sachen beschäftigt: selbst überleben, Trümmer wegräumen, die Wirtschaft ankurbeln. Da war kein Platz für Erinnerungen. Also wurde geschwiegen.
Dann kamen die Jahre, als es politisch nicht klug war, über das zu reden, was Millionen Deutsche erlebt und erlitten hatten. Es ging um die Anerkennung von Grenzen, um die Sicherheit östlicher Nachbarn, die alte Besitzansprüche fürchteten. Es ging auch um Versöhnung, die allen Seiten nicht leicht fiel. Unüberhörbar und nicht selten radikalisiert meldeten sich die organisierten Vertriebenen und ihre Sprecher zu Wort. Die meisten aber hatten Angst, in eine revanchistische Ecke gestellt zu werden. Also wurde lieber wieder geschwiegen.
Die Zeiten haben sich geändert. Gott sei Dank. Die Vertriebenen von einst besuchen die Menschen in ihrer früheren Heimat, knüpfen Kontakte mit denen, die heute in ihren Häusern wohnen, ihre Felder bewirtschaften. Es wird miteinander geredet. Es wachsen neue Generationen heran. Den einen ist klar geworden, dass Flucht und Vertreibung nicht vom Himmel fielen, sondern eine Folge des Krieges und der von Deutschen begangenen Gräuel waren. Die anderen sprechen inzwischen offen darüber, dass die ethnische Säuberung eben doch mit brutalsten Verbrechen verbunden war, nicht eine wohl organisierte Umsiedlung, wie so lange behauptet wurde.
Die Menschen dürfen sich wieder erinnern. Vielleicht hätten die Alten unter den Vertriebenen leichter ihren Frieden gefunden, wenn sie noch hätten erleben können, dass die Menschen neugierig geworden sind auf diese Geschichte: Wie habt ihr damals zu Hause gelebt? Wie sah euer Alltag aus? Was hat euch Kraft gegeben? Wie war es, wenn ihr gesungen und gefeiert, wenn ihr getrauert habt? Was habt ihr erlebt in den Viehwaggons, auf dem Transport mit dem Panjewagen – halb erfroren, fast verhungert, schutzlos den Granaten der Tiefflieger ausgeliefert? Warum seid ihr nicht verrückt geworden, als ihr die toten Kinder im Schnee vergraben habt? Wie konntet ihr euren Platz in einer Welt finden, die für euch fremd war – unter Menschen, die euch nicht vor lauter Freude um den Hals gefallen sind, als ihr in Lumpen und verlaust auf den Bahnhofsgleisen standet?
Erinnern und Erzählen ist möglich geworden: Schüler laden alte Menschen in den Unterricht ein und hören ihnen zu, statt gelangweilt aus dem Fenster zu schauen. Junge Menschen gehen auf Spurensuche, fahren in die Heimat ihrer Eltern und Großeltern.
Ohne die oft katholischen Menschen, die in die norddeutsche Diaspora kamen, würde es das Bistum Hildesheim in der heutigen Form überhaut nicht geben. Vielerorts zwischen Göttingen und Cuxhaven sind die Gemeinden von der Mentalität der Schlesier geprägt: Als sie zu hunderttausenden kamen, gaben die deutschen Bischöfe eine Handreichung heraus, damit die heimischen Priester wussten, wen sie hier vor sich hatten: „Es sind Menschen, denen ihr gemütliches Heim über alles geht. Sie sind gutmütig, gastfreundlich und fromm und gehen gerne in ihre von außen schlichten, aber innen prächtig geschmückten Kirchen.“